STOLPERSTEINE GELSENKIRCHEN
Ausgrenzung erinnern

← STOLPERSTEINE Gelsenkirchen
|
HIER WOHNTE
 FRIEDERICH POBURSKI FRIEDERICH POBURSKI
Jg. 1897
ZEUGE JEHOVAS
VERHAFTET 1939
SACHSENHAUSEN
1944 BERGEN-BELSEN
TOT 16.4.1945
|
Verlegeort: Vandalenstraße 14, Gelsenkirchen
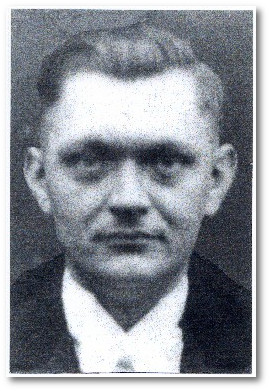
Friederich Poburski, vor 1938
Friedrich Poburski, geboren am 11. April 1897 in Freudenthal /Westpreußen, zog 1926 mit seiner Familie nach Gelsenkirchen. Dort lebte er mit seiner Frau Hedwig und der Tochter Hedwig-Elli in der Vandalenstraße 14. Poburski fand Arbeit bei einer Baufirma in Gelsenkirchen, wo er jedoch einen Arbeitsunfall erlitt. Sein Bein wurde dabei so schwer verletzt, dass er fortan eine Prothese tragen musste. Die Firma entließ ihn allerdings nicht, sondern beschäftigte ihn weiter als Nachtwächter. 1935 ließ sich Friedrich Poburksi als Zeuge Jehovas taufen, zu einer Zeit, als die Religionsgemeinschaft bereits seit zwei Jahren verboten war.
Da Friedrich Poburski auf Grund seiner christlichen Neutralität nicht zur Wahl ging, geriet er ins Visier der Nationalsozialisten. Die Gestapo führte mehrfach Hausdurchsuchungen in der Vandalenstraße durch, fand aber kein belastendes Material. Poburski hatte in der Speisekammer ein Geheimfach eingerichtet, wo die verbotene Wachtturm-Literatur unentdeckt blieb. Zusammen mit dem Gelsenkirchener Zeugen Jehovas Gustav Gunia verteilte Friedrich Poburksi die Literatur an Glaubensbrüder im Umkreis der Stadt. Gunia wurde ebenfalls Opfer der Verfolgung und war acht Jahre in Gefängnissen und Konzentrationslagern inhaftiert. Er überlebte die Diktatur. 1935 kam es zu Friedrich Poburskis erster Verhaftung in Gelsenkirchen. Das Essener Strafgericht verurteilte ihn anschließend zu einer dreimonatigen Gefängnisstrafe. Wo er diese verbrachte, ist bisher nicht bekannt.
|
Nach Verbüßung der Haft befand er sich zunächst wieder in Freiheit. 1937 verhaftete man Friedrich Poburski erneut, allerdings nur für einen Tag. Seine dritte Verhaftung erfolgte am 24. Mai 1938. Zunächst war er im Polizeigefängnis Gelsenkirchen inhaftiert. Das Sondergericht Dortmund, das in Gelsenkirchen tagte, verurteilte Poburksi am 8. Juli 1938 „wegen verbotener Bibelforschertätigkeit" zu einem Jahr und vier Monaten Gefängnis. Seine Überstellung in das Strafgefängnis Bochum (Krümmede) erfolgte am 20. Juli 1938 (Quelle: Institut für Stadtgeschichte Gelsenkirchen, ISG StadtA Ge/Wgm 1082). Friedrich Poburskis Tochter Hedwig-Elli konnte ihren Vater im September 1939 in Bochum besuchen. Dort erzählte ihr der Vater, dass ihm eine Erklärung zum Abschwören seines Glaubens vorgelegt worden war, er sich jedoch geweigert hatte, sie zu unterschreiben. Da er wusste, dass dies die Einlieferung in ein Konzentrationslager bedeuten würde, führte Friedrich Poburski mit Absicht eine Entzündung an seinem Knie herbei, um so außerhalb des Gefängnisses eine neue Prothese zu bekommen. Er plante, darin eine Bibel in das Konzentrationslager einzuschmuggeln. Dies gelang ihm tatsächlich auch.
Am 17. Oktober 1939 holte die Polizei Friedrich Poburski aus dem Gefängnis Bochum ab. Seine Einlieferung in das KZ Sachsenhausen ist für den 2. November 1939 belegt. Dort erhielt er die Häftlingsnummer 3329. Offensichtlich verbrachte man Friedrich Poburski zu einem späteren Zeitpunkt in ein anderes Lager, welches bisher nicht bekannt ist. Poburski wurde am 6. März 1941 ein weiteres Mal im KZ Sachsenhausen eingeliefert und erhielt diesmal die Häftlingsnummer 12785. 1942 wurde er zeitweise einem der Aussenkommandos des Lagers zugeteilt, Dauer und Ort sind nicht bekannt.
Dass er im Konzentrationslager als Invalide nicht der Vergasung zum Opfer fiel, verdankte Friedrich Poburksi seinem Glaubensbruder Ernst Seliger, der im KZ Sachsenhausen die Aufsicht über die Krankenstation führte. Seliger forderte mit Erfolg Friedrich Poburksi als Hilfskraft für die Station an und ermöglichte ihm so das Überleben. Ende 1944 überführte man ihn schließlich mit einem Kommando in das KZ Bergen-Belsen (Quellen: Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen, Signatur D 1 A/1024, Bl. 363 sowie D 1 C/01, Bl. 180; Institut für Stadtgeschichte Gelsenkirchen, ISG StadtA Ge/Wgm 1082).
Nach Kriegsende machten sich im Sommer 1945 zwei Zeugen Jehovas aus dem Düsseldorfer Raum auf den Weg ins KZ Bergen-Belsen, um Friedrich Poburskis Schicksal in Erfahrung zu bringen. Wie sie dort von Überlebenden erfuhren, hatte Poburksi am 15. April 1945 noch die Befreiung des Lagers durch die Briten erlebt. Doch nur einen Tag später, am 16. April 1945, verstarb Friedrich Poburksi im Alter von nur 48 Jahren an Hungertyphus.
Die Ehefrau Hedwig Poburski und ihre Tochter waren nach der Ausbombung Gelsenkirchens Mitte November 1944 nach Bünde/Westfalen evakuiert worden. Beide bekannten sich nach dem Krieg ebenfalls zum Glauben der Zeugen Jehovas. Hedwig Poburksi stellte im August 1952 beim Kreis-Anerkennungs-Ausschuß für den Stadtkreis Gelsenkirchen für ihren verstorbenen Mann einen Antrag auf Anerkennung als Verfolgter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Seine Anerkennung erfolgte am 12. Mai 1953. Im September 1956 gewährt der Ausschuß Hedwig Poburksi und ihre Tochter als Erben eine Entschädigung (Quelle: Institut für Stadtgeschichte Gelsenkirchen, ISG StadtA Ge/Wgm 1082).
Viele Einzelheiten dieser Biographie entstammen den Erinnerungen der heute 86-jährigen Tochter Elli-Hedwig Poburksi. Alle Dokumente zur Verfolgung von Friedrich Poburksi verbrannten bei der Bombardierung Gelsenkirchens. Ein einziges Foto von Friederich Poburski, leider etwas unscharf, ist jedoch erhalten geblieben.
Mit freundlicher Genehmigung, Jehovas Zeugen in Deutschland
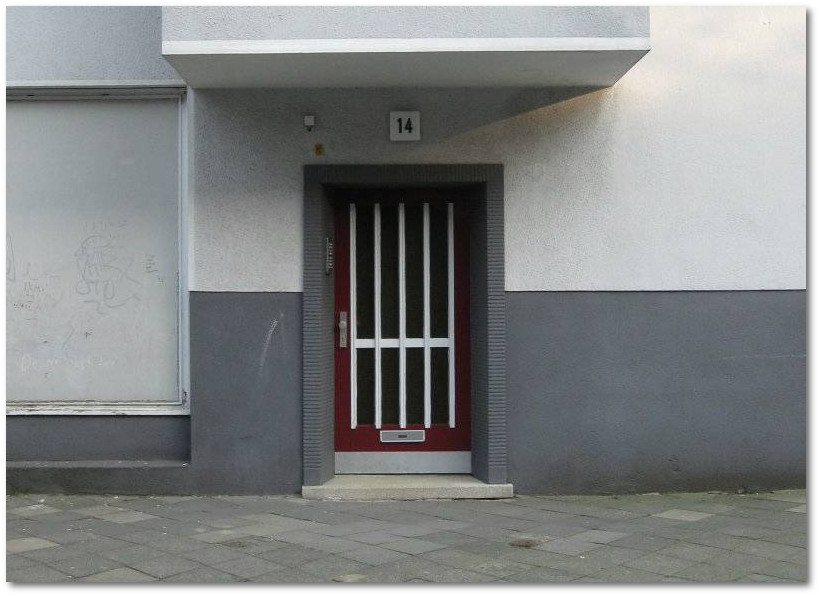
Die Vandalenstrasse 14 im April 2011.
→ Fotostrecke von der Verlegung des STOLPERSTEINS an der Vandalenstrasse 14
|